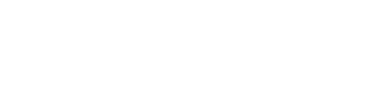
Kontakt
Viromed Medical GmbH
Flensburger Str. 18
25421 Pinneberg
Plasmatherapie
Weitere Produkte
© Viromed Medical GmbH
PD Dr. Julia Zimmermann*, Dr. Lisa Gebhardt*, Prof. Dr. Dr. h.c. Gregor Morfill*, Jens Kirsch*, PD Dr. Markus Perbandt**
*terraplasma medical GmbH ist Hersteller des plasma care® welches seit Juni 2019 in der Europäischen Union als Medizinprodukt der Klasse IIa zugelassen ist.
**Viromed Gruppe, ist das führende Unternehmen für Diagnostik und digitale Vernetzung.
Kaltes atmosphärisches Plasma besteht aus vielen Komponenten, darunter sogenannte reaktive Spezies, welche auf unterschiedliche Art und Weise mit biologischen Materialien interagieren können. Während diese Spezies auf Bakterien (inklusive multiresistente Erreger) und Viren inaktivierend wirken, wird in gesunden humanen Zellen das Zellwachstum angeregt. Dies macht man sich bereits in der Wundversorgung zu Nutze, denn mehrere Anwendungsbeobachtungen und Studien zeigen bereits den wundheilungsfördernden Effekt von kaltem atmosphärischem Plasma. Zusätzlich ist auch die heilungsfördernde Wirkung bei verschiedenen Hauterkrankungen wie Akne und Aktinischer Keratose dokumentiert. Die Anwendung von kaltem atmosphärischem Plasma ist mit wenig Aufwand verbunden und kann als Add-on zur herkömmlichen Therapie eingesetzt werden.
Doch nicht nur äußerlich können Bakterien eine medizinische Herausforderung darstellen. Beatmungsassoziierten Pneumonien (Ventilator-associated pneumonia – VAP) sind während maschineller Beatmung auftretende Infektionen der Atemwege. Diese Komplikationen treten besonders im Zuge des durch die Corona Pandemie verstärkten und häufig längerfristigen Bedarf nach maschineller Beatmung auf. Hier kann kaltes atmosphärisches Plasma, welches mittels Druckluft durch einen Schlauch in den Rachenraum eines beatmeten Patienten eingeleitet wird, helfen. Das Plasma unterstützt die Mundpflege durch seine antibakterielle Wirkung und reduziert somit den Pflegeaufwand. In Versuchen konnte in-vitro eine sehr gute Reduktion von Bakterien im Rachenraum durch kaltes Plasma und auch der inaktivierende Effekt auf SARS-CoV-2 Viren nachgewiesen werden. Perspektivisch kann dies ebenfalls in frühen Stadien einer COVID-19 Erkrankung genutzt werden, um die SARS-CoV-2 Virenlast in den oberen Atemwegen zu reduzieren und so einem schwerwiegenden Verlauf entgegenzuwirken.
Bakterien und Viren im Rachenraum stellen eine große Herausforderung für die Medizin dar: Beatmungsassoziierte Pneumonien (Ventilator-associated pneumonia – VAP) sind Infektionen der Atemwege, die frühestens 48h nach dem Beginn einer maschinellen Beatmung auftreten. Sie sind eine der häufigsten und gefährlichsten Komplikationen der maschinellen Beatmung.
In einer am Uniklinikum Regensburg durchgeführten Studie an verstorbenen COVID-19 Patienten wurde festgestellt, dass bei 90% eine Sekundär-Infektion der Lunge durch Bakterien vorlag. In großangelegten Studien ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass etwa 10% der beatmeten Patienten eine VAP entwickeln1. Der Krankenhausaufenthalt wird dabei um 6-9 Tage verlängert[2], was wiederum das Risiko für weitere nosokomiale Infektionen, insbesondere mit multiresistenten Erregern (MRE) steigen lässt. Die Mortalität im Zusammenhang mit VAP wird auf 13% geschätzt und ist somit höher als bei den chirurgischen Intensivpatienten[3-5].
Aktuelle Maßnahmen zur Vorbeugung von beatmungsassoziierten Pneumonien sind nur bedingt wirksam; es fehlen effektive und nachhaltig wirksame Methoden, welche das Risiko für das Auftreten einer VAP für die Intensivpatienten senken. Als neue Innovation in der Intensivmedizin, soll mit dem plasma intensive care® die in der Wundbehandlung etablierte Plasma-Technologie, für diesen Anwendungsbereich eröffnet und so die effektive Prävention von VAP durch eine Verbesserung der Mund-/Rachenhygiene erreicht werden. Hierbei ist neben der effektiven Inaktivierung von Bakterien auch die Entlastung des Pflegepersonals ein wichtiger Faktor: Die gründliche Pflege und Reinigung des Mundraums eines Intensivpatienten benötigt bislang etwa 8 Minuten, eine Anwendung mit dem plasma intensive care® hingegen 2 Minuten. Neben der Zeitersparnis von ca. einer Stunde bei 10 beatmeten Patienten, ist auch die Sicherheit der Pflegekräfte zu betrachten. Diese müssen sich um das plasma intensive care® anzuwenden nicht mehrere Minuten über einen potenziell hochinfektiösen Patienten beugen, sondern können mit einem gewissen Abstand die Behandlung starten.
Abbildung 1: plasma intensive care®
Das plasma intensive care® ist ein mobil einsetzbares Medizinprodukt, welches sich momentan in der Zulassung befindet, mit dem Ziel der Prävention von beatmungsassoziierten Pneumonien mit Hilfe von kaltem Plasma. Es wird kaltes Plasma erzeugt und mit Hilfe von medizinischer Druckluft über den Mund sanft in die oberen
Atemwege des beatmeten Patienten geleitet. Das Plasma wirkt stark antibakteriell, antiviral und antimykotisch und ist somit in der Lage die mikrobielle Besiedlung der oberen Atemwege um bis zu 5-log Stufen zu verringern, ohne dabei die Schleimhaut des Patienten zu schädigen. Das Gerät wird ausschließlich bei intubierten bzw. tracheotomierten Patienten eingesetzt, so dass der gesamte Respirationstrakt oberhalb des Cuffs behandelt wird. Das plasma intensive care® kann so maßgeblich zur Prävention von beatmungsassoziierten Pneumonien beigetragen.
Abbildung 2: log-Reduktion bei der Behandlung verschiedener Bakterienstämme im Modellversuch
Schematische Darstellung der Behandlung von invasiv beatmeten Patienten mit dem plasma intensive care
Die Anwendung des plasma intensive care® ist schnell und einfach durchführbar, schmerzlos, kosteneffizient sowie wirtschaftlich und stellt somit nach erfolgreicher Zulassung eine ausgezeichnete Ergänzung zu den herkömmlichen Präventionsmaßnahmen dar. Gerade im Rahmen der COVID-19 Pandemie ist die Indikation für eine maschinelle Beatmung und somit auch die Prävalenz von beatmungsassoziierten Pneumonien bei Intensivpatienten stark angestiegen, das plasma intensive care® wäre hier äußerst hilfreich, um dieser Herausforderung zu begegen[6].
„Für mich ist die Therapie von intensive-beatmeten Patienten mit kaltem Plasma eine äußerst vielversprechende Therapie zur Vermeidung von Beatmungs-assoziierten Pneumonien. Insbesondere bei langzeit beatmeten COVID-19 Patienten bei denen dies oft eine potenzielle letale Komplikation darstellt.“
Prof. Dr. Andreas Link
Leiter Intensivstation ICU und IMC
Universitätsklinikum des Saarlandes
Eine aktuelle Studie zeigt, dass mittels einer kurzeitigen CAP Behandlung eine >99.9% Reduktion von ENT (Ear, nose und throat) Pathogenen erzielt werden kann. Bei Behandlungszeiten von <60s konnten bei Schleimhautzellen lediglich leichte zytotoxische Effekte beobachtet werden [7,8].
In einer weiteren aktuellen Studie wurde das große Potential einer CAP Behandlung bei einer Mittelohrentzündung über die Reduktion von Biofilm-bildenden Bakterien demonstriert9. Diese Untersuchungen unterstreichen das große Potential einer CAP-Behandlung bei ENT Infektionen.
Im Zusammenhang mit der derzeit immer noch andauernden COVID 19 Pandemie führten Chen et al. Ende 2020 Untersuchungen mit kalten Plasmen und SARS-CoV-2 durch10. Die Ergebnisse zeigten, wie erwartet, dass kalte Plasmen hocheffektiv SARS-CoV-2 Viren auf unterschiedlichen Oberflächen reduzieren können.
Um dem weiter nachzugehen, wurden im Labor von Albrecht von Brunn am Max-von-Pettenkofer-Institut in München Tests zur Empfindlichkeit von Coronaviren in Lösung gegenüber einer kalt Plasma Behandlung mit der plasma care durchgeführt. Dabei führte eine 6-minütige CAP-Behandlung zu einer mehr als 60%igen Reduktion der Luziferase-Aktivität in einem Reporter-Assay mit einem genetisch veränderten humanen Coronavirus (229E) bei einer Ausgangskonzentration von 3×10^7 pfu (A. von Brunn & Y. Ma-Lauer, siehe Abbildung 3).
Somit konnte gezeigt werden, dass Coronaviren in Lösung (z.B. im Speichel) mit dem plasma care® inaktiviert werden können.
Gemeinsam eröffnen diese Daten mit den bereits durchgeführten Sicherheitsuntersuchungen an humanen Schleimhautzellen/-gewebe neue Möglichkeiten zur Bekämpfung von COVID-19.
Abbildung 3: Inaktivierung von Coronaviren in Lösung mit dem plasma care®
Um zu klären, ob CAP tatsächlich bei der Behandlung einer COVID-19 Erkrankung helfen kann, wurden nun weitere Untersuchungen sowohl in Zellkulturen als auch mit COVID-19-Patienten initiiert. Dabei soll herausgefunden werden, ob eine CAP Behandlung die Viruslast in Mund, Nase und Rachen von COVID-19-Patienten reduziert und somit ein schwerer Verlauf mit Verlegung auf eine Intensivstation und künstlicher Beatmung verhindert werden kann. Weiterhin soll in diesen vorklinischen und geplanten klinischen Studien herausgefunden werden, ob und welche akuten zytotoxischen und Langzeitwirkungen bei definierten CAP Gerätekonfigurationen ggf. zu erwarten wären.
„Kaltes Plasma ist nicht nur eine vielversprechende Behandlungsform für intubierte Patienten sondern auch für die zukünftige Behandlung von Pneumonien direkt in der infizierten Lunge.“
PD Dr. Manfred Stangl
Leitender Oberarzt, Pulmologe
Transplantationszentrum LMU München
Das Ziel ist es, einen Risikopatient der sich mit dem Corona-Virus infiziert hat, umgehend mit dem plasma care eine Therapie zu beginnen und ihn mit Kaltplasma behandeln zu können. Dabei wird kaltes Plasma in die oberen Atemwege appliziert, um dadurch die virale Last zu reduzieren. Die Reduktion der Corona-Viren in den oberen Atemwegen würde dazu führen, dass deutlich weniger Corona-Viren in die Lunge vordringen können. Somit könnte eine massive Lungenentzündung vermieden werden und das Immunsystem würde Zeit gewinnen sich gegen die verbleibenden Corona-Viren zu wehren und natürliche Abwehrkräfte aufzubauen.
Abbildung 4: Illustration einer möglichen Applikation von kaltem Plasma zur Behandlung der oberen Atemwege zur Reduktion respiratorischer Pathogene wie SARS-CoV-2
Während die meisten Wunden innerhalb kurzer Zeit heilen, leiden etwa 4 Mio. Menschen allein in Deutschland unter chronischen Wunden – Wunden, die trotz leitliniengerechter Versorgung innerhalb von acht Wochen nicht abheilen. Die Ursachen für eine Wundheilungsstörung können vielschichtig sein, auch die Altersstruktur, Vorerkrankungen und damit einhergehende unzureichende Durchblutung, Fremdkörper in der Wunde sowie eine eventuelle Bakterienbesiedelung können einen Anteil daran haben[11-14]. Der Verlust an Lebensqualität ist durch die mit einer chronischen Wunde einhergehende Immobilität und den hohen Therapieaufwand auch bei schmerzlosen Wunden für die Betroffenen sehr hoch. Gerade Wundinfektionen stellen dabei auch für den Behandelnden aufgrund der zunehmenden Antibiotika-Resistenzen immer häufiger große Herausforderungen dar.15,16 Durch CAP kann die Keimlast in der Wunde signifikant reduziert und zudem das Zellwachstum angeregt werden.[17-20]
Seit 2019 ist das plasma care® als erstes handliches und batteriebetriebenes Medizinprodukt der Klasse IIa in der Europäischen Union für die Wundbehandlung zugelassen.
Das plasma care® Gerät (Abbildung 5) zeigte in Laborversuchen eine exzellente Wirkung gegen verschiedene Bakterien, welche häufig in Wunden aufgefunden werden, einschließlich MRSA (Abbildung 8). Die Anwendung des plasma care® ist als Add-on zur herkömmlichen Wundbehandlung mit wenig Aufwand verbunden. Das Gerät wird lediglich während des Verbandwechsels und nach Reinigung der Wunde für 1 Minute auf die Wunde aufgesetzt. Eine anschließende Behandlung der Wunde mit Antibiotika oder Salben kann, falls gewünscht, wie gewohnt durchgeführt werden. Eine zwei bis drei Mal pro Woche durchgeführte Behandlung mit CAP zeigte in den meisten Fällen bereits in der zweiten Woche positive Effekte auf die Wundheilung.
Insgesamt wurde das plasma care® bereits bei mehr als 3.000 Patienten in über 30.000 erfolgreichen Behandlungen eingesetzt. Hierbei wurden keine Schmerzen aufgrund der Anwendung berichtet (Beispiele in Abbildung 5 und 6).
Abbildung 5: plasma care® – ein Medizinprodukt Klasse IIa zur Behandlung von Wunden mit kaltem atmosphärischem Plasma
Abbildung 6: Beispiel 1: Dekubitus im Nacken: Sieben Kaltplasma-Behandlungen in drei Wochen, die ersten Behandlungen wurden an aufeinander folgenden Tagen durchgeführt; Vollständige Ephithelisierung nach 22 Tagen.
Abbildung 7: Beispiel 2: Diabetisches Fußsyndrom: Zwei Behandlungen mit CAP pro Woche in den ersten drei Wochen, anschließend alle 14 Tage (Neun Behandlungen in 12 Wochen); Abheilung innerhalb von 12 Wochen nach Beginn der Plasmatherapie
Abbildung 8: Ergebnisse der Inaktivierung von RK II-Bakterien bei 1 min CAP-Behandlung. Dargestellt sind die Mediane der log Reduktion und die dazugehörigen Fehler (Maxima/Minima) von sechs unabhängigen Experimenten.
Neben der Wundbehandlung wird CAP in der Dermatologie bereits als vielversprechende Möglichkeit beispielsweise bei Akne und Aktinischer Keratose gesehen.[21-25]
Kaltes atmosphärisches Plasma (Cold Atmospheric Plasma – CAP) ist ein teilweise ionisiertes Gas, das aus einem reaktiven Mix aus Elektronen, Ionen, angeregten Atomen und Molekülen, reaktiven Spezies (wie z.B. reaktive Sauerstoff und Stickstoff Spezies (RONS)), UV-Strahlung und Wärme besteht.
Die Wechselwirkung von CAP mit verschiedenen biologischen Materialien wurde in den letzten zwei Dekaden extensiv untersucht [26-30]:
CAP zerstören und inaktivieren hocheffizient Bakterien (inklusive multiresistente Erreger wie z.B. MRSA) und Viren – wie zahlreiche Publikationen demonstrieren [31-34]. Die durch das Plasma induzierten Prozesse (z.B. Elektron-Ion Rekombination, RONS etc.) verursachen winzige Poren in den Membranen der Pathogene. In Bakterien und Viren zerstören diese Zellstrukturen einschließlich der freiliegenden DNA, was zur Inaktivierung der Pathogene führt. Antibiotika- und andere Resistenzen haben hierbei keinen Einfluss.
Im Vergleich zu den Pathogenen sind humane Zellen – auf Grund ihres schützenden Zellkerns und zellulärer Reparaturmechanismen – weitaus widerstandsfähiger gegen das eindringende Plasma und werden bei kurzzeitiger Exposition nicht geschädigt [35-38]. In vitro Studien zeigen zudem, dass der durch das kalte Plasma induzierte oxidative Stress zellbiologische Überlebensmechanismen sogar stimuliert [39-43]. Dies erklärt die in diversen klinischen Studien und Fallberichten belegte verbesserte Wundheilung.[44-47]
Referenzen: